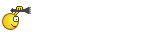Wir haben uns LEP-Module bestellt und ich habe mir eins mal näher angesehen.
Bestellt hatten wir das TLLOE01 / GCF-T-55K-600 (Alibaba-Link). Das war dann aber nicht erhältlich und wir haben einvernehmlich ein ähnlich aussehendes in Alu statt Messing genommen (offenbar nur Material-Änderung und ein anderes Gehäuse-Gewinde).

Nehmen wir einfach mal an, dass die elektrischen/optischen Daten gleich sind.
Laut Herstellerangabe hätte es
Lichtstrom
Der Lichtstrom ist schnell gemessen, wenn man eine Lumenkugel und eine Kalibriermöglichkeit hat. Meine Lumenkugel hat schon ewig keine bekannte Quelle mehr gesehen, aber mir reicht die Größenordnung.

Strom [A] - Lichtstrom [lm]
1.08 - 230
2.08 - 535 (13.05. ergänzt)
2.58 - 650 (13.05. Strom korrigiert)
3.08 - 790
4.08 - 990
Die krummen Stromwerte sind eine Eigenheit meines Labornetzgerätes.
Fazit: Wert sogar übererfüllt. Immerhin: Es gibt nicht nur China-Lumen! Aber: Der Lichtstrom ist hier vergleichsweise nebensächlich...
Leuchtdichte
Die Leuchtdichte ist deutlich schwieriger zu bestimmen. Rechnerisch geht hier gar nichts, da im Gegensatz zur LED die Leuchtdichte hier zum Rand hin stetig abnimmt. Ich hab es mit einer Projektion und Luxmeter probiert (ganz ähnlich wie im Wavien-Versuch)

Und hier sieht man ein A4-Papier an der Decke mit dem Bild des leuchtenden Moduls:

Ziel: Den Kern der leuchtenden Fläche unterscheiden zu können und gleichzeitig etwas mit bekanntem Maß drumherum (Gehäuse oder Phosphor-Rand). Auf diesem Bild ist das ganz gut hingekommen. Das größte Maß mit der Schieblehre, alle anderen dann durch Pixelzählen

(die Pfeile hier nur zur Erklärung, nicht zum Pixelzählen)
Langer blauer Pfeil - Innendurchmesser erhobener Metallring (Messschieber): 6.39 mm
kurzer blauer Pfeil - Phosphorfläche die leuchten kann: 2.89 mm (das gesamte Plättchen ist eingelassen und etwas größer)
langer grüner Pfeil - Durchmesser schmaler, etwas weniger heller Randbereich um den Kern: 0.75 mm
kurzer grüner Pfeil - Durchmesser hellster Kernbereich: 0.58 mm
Als definierte Quelle eine Blende auf dem Objektiv: Gelochte Pappe (d=5.4mm), Entfernung zur Decke 146 cm, Strom 3.08 A, Beleuchtungsstärke im Kern 5800 lx
=> 12400 cd
Vorteil dieser Methode: Die weniger hell leuchtenden Flächen um den Kern sind völlig egal.
Nachteil: Unbekannter Verlust im Objektiv zwischen Quelle und Blende. Ich hatte keine bekannte Quelle (mein "Homeoffice" ist derzeit 80 km von meiner "Werkstatt" entfernt :- ) Ich hab den Faktor genommen, den ich damals beim Wavien-Versuch nur nebenbei zur groben Kontrolle der Messung bestimmt habe: 107/125, also 86 % Transmission.
Somit wären das
Später, letztes Wochenende konnte ich dann mein Modul mit einem zweiten Modul vergleichen, das noch bei Xandre lag. Idee: In Reihe geschaltet ans Labornetzgerät geklemmt und in die Lumenkugel gehalten => Glücklicherweise praktisch identisch. Somit kein bleibender Schaden, puh. Meine Messung wäre auf manche Art sinnvoller möglich gewesen (war eh alles kompliziert, z.B. da ich bei der Leuchtdichtemessung die Lumenkugel nicht da hatte, alles am selben Abend wieder abgebaut werden musste, etc.) - jedenfalls: Nochmal Glück gehabt...
Und sonst:
Lesestoff:
Bestellt hatten wir das TLLOE01 / GCF-T-55K-600 (Alibaba-Link). Das war dann aber nicht erhältlich und wir haben einvernehmlich ein ähnlich aussehendes in Alu statt Messing genommen (offenbar nur Material-Änderung und ein anderes Gehäuse-Gewinde).

Nehmen wir einfach mal an, dass die elektrischen/optischen Daten gleich sind.
Laut Herstellerangabe hätte es
- bei einem Nennstrom 2.5 A (maximal 3A, thermische Grenze des Phosphors)
- Spannung dabei typ. ~5V,Leistung typ. 14 W
- 600 lm
- 750 cd/mm²
- Leuchtfläche 0.2 mm² . Das entspräche einem Durchmesser von 0.5 mm. (Aber unklar, was genau der Hersteller meint, da die Helligkeit zum Rand abnimmt.)
- CRI 65, CCT 5500 K
- 30% Wirkungsgrad
Lichtstrom
Der Lichtstrom ist schnell gemessen, wenn man eine Lumenkugel und eine Kalibriermöglichkeit hat. Meine Lumenkugel hat schon ewig keine bekannte Quelle mehr gesehen, aber mir reicht die Größenordnung.

Strom [A] - Lichtstrom [lm]
1.08 - 230
2.08 - 535 (13.05. ergänzt)
2.58 - 650 (13.05. Strom korrigiert)
3.08 - 790
4.08 - 990
Die krummen Stromwerte sind eine Eigenheit meines Labornetzgerätes.
Fazit: Wert sogar übererfüllt. Immerhin: Es gibt nicht nur China-Lumen! Aber: Der Lichtstrom ist hier vergleichsweise nebensächlich...
Leuchtdichte
Die Leuchtdichte ist deutlich schwieriger zu bestimmen. Rechnerisch geht hier gar nichts, da im Gegensatz zur LED die Leuchtdichte hier zum Rand hin stetig abnimmt. Ich hab es mit einer Projektion und Luxmeter probiert (ganz ähnlich wie im Wavien-Versuch)

Und hier sieht man ein A4-Papier an der Decke mit dem Bild des leuchtenden Moduls:

Ziel: Den Kern der leuchtenden Fläche unterscheiden zu können und gleichzeitig etwas mit bekanntem Maß drumherum (Gehäuse oder Phosphor-Rand). Auf diesem Bild ist das ganz gut hingekommen. Das größte Maß mit der Schieblehre, alle anderen dann durch Pixelzählen

(die Pfeile hier nur zur Erklärung, nicht zum Pixelzählen)
Langer blauer Pfeil - Innendurchmesser erhobener Metallring (Messschieber): 6.39 mm
kurzer blauer Pfeil - Phosphorfläche die leuchten kann: 2.89 mm (das gesamte Plättchen ist eingelassen und etwas größer)
langer grüner Pfeil - Durchmesser schmaler, etwas weniger heller Randbereich um den Kern: 0.75 mm
kurzer grüner Pfeil - Durchmesser hellster Kernbereich: 0.58 mm
Als definierte Quelle eine Blende auf dem Objektiv: Gelochte Pappe (d=5.4mm), Entfernung zur Decke 146 cm, Strom 3.08 A, Beleuchtungsstärke im Kern 5800 lx
=> 12400 cd
Vorteil dieser Methode: Die weniger hell leuchtenden Flächen um den Kern sind völlig egal.
Nachteil: Unbekannter Verlust im Objektiv zwischen Quelle und Blende. Ich hatte keine bekannte Quelle (mein "Homeoffice" ist derzeit 80 km von meiner "Werkstatt" entfernt :- ) Ich hab den Faktor genommen, den ich damals beim Wavien-Versuch nur nebenbei zur groben Kontrolle der Messung bestimmt habe: 107/125, also 86 % Transmission.
Somit wären das
- auf Höhe der Pappblende (belastbare Messung, aber mit Verlust des Objektivs) 540 cd/mm²
- und abgeschätzt an der Quelle 630 cd/mm²
- Hersteller d=0.5 mm , bei mir d~0.58 mm
- Im Hinterkopf behalten: Die Lumen stammen nicht aus dieser Kernzone, sondern aus dem gesamten, zum Rand hin schwächer werdenden Spot.
- 630(?) statt 750 cd/mm² - das wäre irgendwie gerade noch ok. Aber nicht vergessen: Meine Messung ist eher eine sehr gute Schätzung.
400-500 cd/mm² wäre mit LED+Wavien ganz gut erreichbar. So ein Modul hingegen ist mechanisch deutlich einfacher. - Nachtrag 13.05.: Gemessen bei Max-Spezifikation 3A (Fehler-Minimierung), Herstellerangaben aber bei 2.5A!
=> Korrektur von 630(?) auf 530 cd/mm², anhand Lumenmessungen. Wäre mit Blick auf Datenblatt nicht mehr so ganz ok. Ein Vorteil gegenüber LED+Wavien bleibt immerhin. Das Modul kann ja noch höher bestromt werden:
2.58 A: 530 cd/mm²
3.08 A: 630 cd/mm²
4.08 A: 790 cd/mm² (Lebensdauer?)
Später, letztes Wochenende konnte ich dann mein Modul mit einem zweiten Modul vergleichen, das noch bei Xandre lag. Idee: In Reihe geschaltet ans Labornetzgerät geklemmt und in die Lumenkugel gehalten => Glücklicherweise praktisch identisch. Somit kein bleibender Schaden, puh. Meine Messung wäre auf manche Art sinnvoller möglich gewesen (war eh alles kompliziert, z.B. da ich bei der Leuchtdichtemessung die Lumenkugel nicht da hatte, alles am selben Abend wieder abgebaut werden musste, etc.) - jedenfalls: Nochmal Glück gehabt...
Und sonst:
- Ich habe keinen Schimmer, wie der Hersteller die Fokussierung umsetzt - das scheint mir hier das A-und-O
Ich hab's auch nicht versucht zu öffnen (ob sich da was optimieren lässt, und wenn ja, dann bringt das sehr ordentlichen Fummel- und Messaufwand mit sich). - Bisher hatte ich den Eindruck, dass die Module in kommerziellen LEP-Leuchten so 400-500 cd/mm² haben, das war aber auch nur eine möglichst gute Schätzung.
- Ich hab noch gar nicht versucht abzuschätzen, was für ein Lasermodul da eigentlich verbaut sein mag.
- Ich frage mich was/ob da für ein Treiber drin ist.
- Und last but not least: Jetzt muss man's noch irgendwo einbauen. Einen Prototyp haben wir schon. Aber: Justage im Reflektor / vor Linse ist bei so einer kleinen Quelle nicht ohne (wir arbeiten derzeit nur mit Dauerprovisorien :- )
Lesestoff:
- Grundlagenrecherche zum Thema Laser Phosphor (The_Driver)
- Lux, Lumen, Candela, Leuchtdichte
- Excalibur (The_Driver - anspruchsvoller Versuch, eine Laser selbst auf einen LED-Phosphor zu fokussieren)
- Reglementierung LEP-Lampen
- Weiterentwicklung der LED-Technik, LEP im Speziellen
- LEP-Taschenlampen-Technik vs. LED
Zuletzt bearbeitet: